Dem lebenslangen, von den Widrigkeiten seiner Zeit ungebrochenen Schöpfungsdrang des Züchters Georg Arends verdanken wir mehr als 350 wundervolle Sorten. 

Gärtner beim Topfen im Freien am Teich, in den 20er Jahren.
[dropcap_1 color=““]O[/dropcap_1]b Moos-Steinbrech, Phlox, Bergenien oder die berühmten Astilben, in unzähligen Gärten finden sich bis heute Spuren des Mannes, der zweifelsohne zu den Urvätern der deutschen Staudenzüchtung gehört: Georg Arends. Einerseits wurde dem am 21. September 1863 geborenen Essener seine Leidenschaft für Pflanzen bereits in die Wiege gelegt, denn seine Eltern betrieben eine erfolgreiche „Kunst- und Handelsgärtnerei“, in der der Bub und seine sechs Geschwister bereits früh die ganze gartenbauliche Bandbreite kennenlernten. Andererseits hätte dieser intensive Kontakt der Begeisterung auch früh ein Ende setzen können, denn die Kinder mussten bei vielem ganz selbstverständlich mit anpacken. Die Eltern verstanden es dennoch, ihren Kindern die Liebe zu den mannigfaltigen Gewächsen zu vermitteln, und für alle Arbeiten „erhielten wir als Belohnung kleine Bezahlungen, die wir für unsere Spardosen verwandten“, wie sich Georg Arends in seiner 1951 bei der Verlagsbuchhandlung Eugen Ulmer erschienen Biografie „Mein Leben als Gärtner und Züchter“ erinnerte. Die wertvollen Erfahrungen in der elterlichen Gärtnerei trugen ihren Teil dazu bei, dass Arends später seine eigene Betriebsgründung so zielstrebig und wohldurchdacht anging. Zunächst einmal begann er jedoch nach seiner Realschulzeit in Essen 1879 eine Lehre bei der Gärtnerei Thiedemann in Hagen, an die er 1882 ein Studium an der höheren Lehranstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau in Geisenheim bei Wiesbaden anschloss. Dort entdeckte er auch sein zeichnerisches Geschick, das er während seiner 1884 aufgenommenen Gehilfenstellung im Botanischen Garten Breslau weiter verfeinern konnte: Für die von Gartenbauinspektor Berthold Stein herausgegebene Zeitschrift „Gartenflora“ brachte er mit feinem Strich zahlreiche präzise Pflanzenillustrationen zu Papier. Dieses Talent verfolgte Arends später allerdings nicht weiter, da er von der allmählich aufkommenden Technik der Fotografie fasziniert war, was sich in über 1000 mit großem Geschick gefertigten und sorgfältig archivierten Glasnegativen niederschlug. Mithilfe der Fotos dokumentierte er unter anderem seine Züchtungsbemühungen und nutzte sie als einer der Ersten für seine bebilderten Kataloge.

Ein Mutterpflanzenquartier mit Lupinen.
Der Weltenbummler der deutschen Staudenzüchter
Im April 1885 führten ihn seine Lehr- und Wanderjahre ins Ausland: In der Gärtnerei Th. S. Ware in Tottenham bei London nutzten sein mitgereister Studienfreund Ernst Pfeifer und er die Nähe zu Kew Gardens für regelmäßige Besuche – besonders der Steingarten hatte es Georg Arends angetan, dessen Schaugarten in Wuppertal später auch für seine Felspartie berühmt wurde – und staunten auf Ausstellungen der Royal Horticultural Society über die Ausbeute von Pflanzenjägern und Züchtern aus aller Welt. Arends war auch von der Vielfalt, die die Gärtnerei selbst bereithielt, beeindruckt, zumal sie „wohl eine der ersten Gärtnereien Englands, die Stauden als Spezialitäten kultivierte“, war. In einem Kalthaus stieß er auf die gerade erst von einer Himalaja-Expedition nach Europa eingeführte Becher-Primel (Primula obconica), mit deren züchterischer Verbesserung er sich bis zu seinem Lebensende beschäftigte (unter anderem gelangen ihm die ersten priminfreien Sorten). Nach einem extrem harten Winter, der zu Arbeitsverkürzungen und damit auch einer empfindlichen Reduzierung des knappen Lohns führte, wechselte Georg Arends im Februar 1886 zur Gärtnerei Guilio Perotti in Italien, wo bereits sein Studienfreund Erich Wocke einer Gehilfentätigkeit nachging. Ein echter Aufstieg, denn trotz seiner gerade einmal 22 Lenze und der durch Hitze und Wassermangel erschwerten Bedingungen arbeitete Georg Arends dort in verantwortlicher Position als Obergärtner. „Zum 1. Oktober 1887 verließ ich meine Stellung, nachdem ich die Genugtuung hatte, den bis dahin unrentabel arbeitenden Betrieb auf eine gesunde Grundlage gebracht zu haben“, zog er beim Abschied von der Gärtnerei Resümee, ehe er zu einer abschließenden Italienrundreise aufbrach. Schritt für Schritt entsteht Ronsdorfs blumige Höh’ Zurück in Deutschland, beschlossen Georg Arends und sein Freund Ernst Pfeifer im Frühjahr 1888, eine eigene Gärtnerei zu eröffnen. Nachdem die Übernahme einer bereits existierenden Gärtnerei in der Nähe von Köln geplatzt war, fiel die Wahl auf Ronsdorf im Bergischen Land – die dort herrschenden rauen Bedingungen kamen Arends später beim Züchten robuster, winterharter Pflanzen gerade recht. Zunächst einmal aber mussten sich die jungen Betriebsinhaber wie schon Georg Arends Eltern einen festen Kundenstamm und einen soliden technischen und finanziellen Grundstock erarbeiten. Der rasche Erfolg war wohl nicht zuletzt auf der Weitsicht der beiden Männer zurückzuführen, die von Beginn an auch auf vielversprechende Neuheiten wie die von Arends heißgeliebte Becher-Primel setzten: Sie legten „besonderen Wert darauf, den Blumengeschäftsinhabern der benachbarten Großstädte (…) an Topfpflanzen und Schnittblumen Besseres zu bieten, als das, was sie von anderen Gärtnereien bezogen.“ Bald schon konnte die Gärtnerei vergrößert werden, allerdings nahm der Betrieb auch aufgrund der Angebotsbreite so viel Zeit in Anspruch, dass die Züchtungsarbeit, die Georg Arends bereits seit Kindertagen faszinierte und die er nun so gerne professionell ausüben wollte, hintenanstehen musste. Aus diesem Grund wagte er 1901 einen Neuanfang und trennte sich im Guten von seinem Geschäftspartner, mit dem er mittlerweile auch verschwägert war – 1891 hatte er Ernsts Schwester Helene Klara Pfeifer geheiratet, die ihm 1894 und 1896 die Söhne Erich und Werner schenkte.

Georg Arends
Der züchterische Durchbruch
1894 gelingt mit der Schleifenblume ‘Weißer Zwerg’ der züchterische Durchbruch. In seinem neuen Betrieb, mit dem er auf einer rund vier Morgen (etwa einen Hektar) großen Fläche der früheren Firma Arends & Pfeifer begann, beschränkte er das Sortiment auf winterharte Stauden, Alpenpflanzen und natürlich die Primula obconica und konnte sich dadurch endlich auf die Züchtungsarbeit konzentrieren. Nun verlief der Firmenaufbau gleich als doppelte Erfolgsgeschichte: Zum einen etablierte sich die Firma Georg Arends rasch am Markt, zum anderen erzielte Arends schon wenige Jahre nach Aufnahme seiner Züchtungstätigkeit erste Erfolge, die ihm die finanziellen Mittel für den weiteren Ausbau des Betriebes einbrachten. Beides war nicht zuletzt auf die Umtriebigkeit Georg Arends’ zurückzuführen: Im Gegensatz zu vielen seiner Berufskollegen, deren mangelndes Interesse an Austausch und Weiterbildung er oft beklagte, hatte er sowohl die Begeisterungsfähigkeit als auch den Ehrgeiz, Kontakte in alle Welt zu pflegen, regelmäßig – und sehr erfolgreich – an nationalen und internationalen Gartenbau-Ausstellungen teilzunehmen sowie sich stets über die Züchtungsansätze und -erfolge von Kollegen auf dem Laufenden zu halten. Dadurch erhielt er nicht nur immer wieder Samen oder gar Pflänzchen als Züchtungsmaterial, er konnte auch differenzieren, bei welchen Pflanzen und im Hinblick auf welche Zuchtziele eine züchterische Bearbeitung überhaupt sinnvoll war. „An vielen Stellen wird an der Verbesserung der Stauden gearbeitet, und die Sortenzahl bei manchen Arten geht schon ins Unübersehbare. Unabhängig voneinander und ohne Kenntnis der Arbeit des anderen werden sowohl bei uns wie auch im Auslande alljährlich Neuheiten herausgebracht, die sich zum Teil kaum mehr als nur durch Namen und Preis unterscheiden“, schrieb Georg Arends in seiner Biografie und begrüßte daher ausdrücklich die Anfänge der Staudensichtung.
Ungebrochene Leidenschaft – auch nach zwei Weltkriegen
Seine Kraft und sein Elan schienen nahezu grenzenlos zu sein – und das war gut so, denn bedingt durch die beiden Weltkriege musste Arends gleich zweimal wieder ganz von vorne beginnen. Im Zweiten Weltkrieg etwa zerstörten Bombenangriffe einen Großteil der baulichen Einrichtungen und mit ihnen zahlreiche wertvolle, teils noch gar nicht auf dem Markt eingeführte Sorten: Die Arbeit von Jahren war innerhalb von Sekundenbruchteilen vernichtet. Anstatt darüber zu verzweifeln, machte Georg Arends sich an den Wiederaufbau. Seiner Begeisterungsfähigkeit konnten die Rückschläge noch weniger anhaben als dem Erfolg seiner gärtnerischen und züchterischen Tätigkeit: Technische Neuigkeiten verfolgte er mit wachem Blick und war stets einer der Ersten, die vielversprechende Erfindungen wie Motor-Bodenfräsen oder Erddampfgeräte in ihrem Betrieben ausprobierten. Von seinem Pioniergeist und seinem Engagement profitierten nicht nur seine Angestellten, sondern ein ganzer Berufsstand: Georg Arends hatte unter anderem über viele Jahre den Vorsitz im „Bund Deutscher Staudenzüchter“ inne, der seine Wurzeln in der 1920 von Arends gegründeten „Vereinigung deutscher Staudenzüchter“ hatte, und setzte sich mit viel Leidenschaft für die Einrichtung einer ersten Versuchsgärtnerei in Bonn-Friesdorf ein. Bis zu seinem Tod am 5. März 1952 war er einer der guten Geister des Gartenbaus in Deutschland und bescherte uns solch wundervolle Sorten wie Astilbe × arendsii ‘Brautschleier’ oder die Hohe Fetthenne (Sedum telephium ‘Herbstfreude’). An sein Lebenswerk erinnert die Georg-Arends-Gedächtnis-Medaille, die höchste Auszeichnung des Deutschen Gartenbaus – seine Schöpfungen selbst leben bis heute in vielen Gärtnereien und Gärten auf der ganzen Welt fort.
Alle Rezepte und Fotos in diesem Artikel sind aus dem Buch:
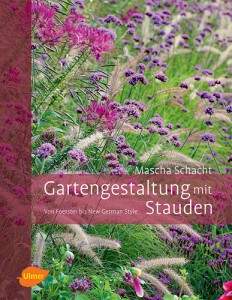
Mascha Schacht:
Gartengestaltung mit Stauden- Von Foerster bis New German Style
Stuttgart, Verlag Eugen Ulmer: 2012
€ 49,90 / (A) € 51,30 / CHF ca. 66,90
ISBN 978-3-8001-7690-8
Ob Westpark in München, Hermannshof in Weinheim, Karl-Foerster- Garten in Bornim oder die Insel Mainau, in modernen Parks und Gärten oder auf der nächsten Verkehrsinsel: Stauden sind aus den heutigen Gärten und Grünanlagen nicht mehr wegzudenken. Doch das war nicht immer so. In ihrem Bildband „Gartengestaltung mit Stauden“ spürt Autorin Mascha Schacht der spannenden und wechselvollen Geschichte der Stauden anhand maßgeblicher Gartengestalter und Züchter wie Karl Foerster, Ernst Pagels und Richard Hansen nach.













