Was tut man nicht alles für seine Lieblingsrosen….gießen, düngen, zupfen. Da kommen Tipps rund um die Pflege und Gesundheit der beliebten Blütendiva gerade recht. Lesen Sie, welchen Übeltätern man beim Gang durchs Rosenbeet auf die Spur kommt, und welche Rosen-Krankheiten man als Pflanzendoktor rechtzeitig erkennen und behandeln sollte.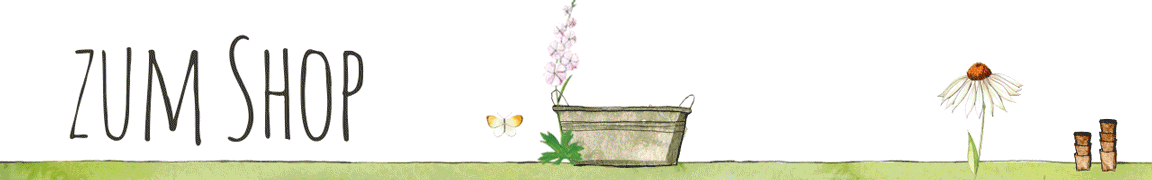

Für Blütennachschub sorgen
Nach dem ersten Blütenflor im Juni sollte man bei öfter blühenden Rosen alles Verblühte abschneiden, um die Nachblüte zu fördern. Außerdem bildet sich an den welken Blüten bei feuchter Witterung schnell Schimmel. Erst entfernt man nur einzelne welke Blüten mit der Schere oder pflückt sie locker mit der Hand ab. Ist der ganze Trieb verblüht, kürzt man diesen auf ein bis zwei Blattpaare ein. Damit die Blüten genügend Kraft für den Blütennachschub haben, versorgt man sie im Juni noch einmal mir Rosendünger.

Rosen lieben lockeren Boden
Am besten gedeihen die Blütengehölze in nährstoffreichen, tiefgründigen Böden. Schwere, lehmreiche Erde steckt zwar voll wertvoller Nährstoffe und Tonmineralien, sie ist allerdings auch stärker verdichtet. Deswegen sollte man schwere, lehmige Böden öfter mit einer speziellen Rosengabel lockern. Dazu sticht man die gezackte Gabel mehrmals rund um die Rose in den Boden und rüttelt sie ein paar Mal hin und her. Die Zinken lockern und lüften die Erde schonend, ohne dabei das empfindliche Wurzelwerk der Rosenpflanzen zu beschädigen. Im Handel gibt es solche Rosengabeln als langgestieltes Gerät fürs Rosenbeet und ebenso als kurze handliche Version für die Rose im Topf. Außerdem hilft das Werkzeug bei der Düngung im Rosenkübel: Mit den Zinken können in den oft stark durchwurzelten und dementsprechend festen Topfballen tiefe Löcher gestochen werden. Der eingestreute Dünger wird anschließend durch sachtes Rütteln im Topf verteilt.
Wenn Triebe wild werden…
Die meisten Gartenrosen sind veredelt und wachsen auf einer Unterlage aus Wildrosen. Man findet die Veredlungsstelle, die etwas wulstartig verdickt ist, in dem Bereich, wo „Wild und Edel“ zusammen wachsen. Hin und wieder schlägt die Wildrose unterhalb der Veredlung mit eigenen Trieben aus. Da diese aber den edlen Rosensorten Kraft und Energie für Ihre Blüten rauben, sollte man die sie entfernen. Man erkennt die Wildtriebe leicht an ihrer stärkeren Stachelung. Bei Stammrosen entspringen die Wildtriebe direkt unterhalb der Krone. Sie erkennt man an ihrer hellgrünen, jungen Rindenfarbe im Vergleich zum älteren Holz des Stämmchens. Wichtig: Den Wildtrieb nicht abschneiden, sonst treibt er immer wieder aus. Stattdessen den Trieb mit einem Ruck ausreißen.

Jetzt noch Rosen pflanzen
Sogenannte Containerrosen kann man jetzt unabhängig von der Saison pflanzen. In Rosengärtnereien, Gartencentern, auf Pflanzenmärkten und Festivals werden zur klassischen Rosenzeit jede Menge blühende Pflanzen in größeren Plastiktöpfen angeboten. Sie kann man sofort ins Beet setzen, da der Wurzelballen voll ausgebildet ist und die feinen Haarwurzeln von Erde umgeben sind. Bereiten Sie ein genügend großes Pflanzloch vor. Tauchen die Rose vor dem Einsetzen samt Topf solange in einen Eimer mit Wasser, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen. Die Rose immer ca. 5 cm tiefer pflanzen als sie vorher im Topf stand und immer darauf achten, dass die Veredelungsstelle unter der Erdoberfläche bleibt. Die Erde rings um den Wurzelballen kräftig andrücken und gut angießen.

Rosen richtig gießen
Gemischte Rosen- und Staudenbeete werden oft von oben beregnet. Das bekommt den Rosen aber nicht, denn auf den benetzten Blättern entwickeln und verbreiten sich gerade an warmen Sommertagen schnell Pilzkrankheiten. In kleineren Beeten kann man das Problem umgehen, indem man die Pflanzen gezielt mit einer Gießkanne oder einem Gießstab versorgt. In größeren Beeten empfiehlt es sich, Tropf- oder Perlschläuche als Bewässerungssystem zu verlegen.

Den Rosenfeinden auf der Spur
Früh übt sich, wer ein Meister werden will! Wer die typischen Schädlinge erkennt, kann gezielt Maßnahmen ergreifen. Kontrollieren Sie regelmäßig ihre Rosen; je eher man die Plagegeister entdeckt, desto schneller wird man sie wieder los. Etwa Blattläuse, ob grün oder schwarz – sie vermehren sich rasant, sitzen meist in dichten Kolonien an den Knospen, Blättern oder jungen Trieben und saugen Pflanzensaft. Sind es nur wenige, kann man die Läuse von Hand abstreifen. Ein starker Wasserstrahl aus dem Gartenschlauch kann auch nicht schaden, allerdings sollte man nicht die offenen Blüten ins Visier nehmen. Man kann auch ein alt bewährtes Hausmittel einsetzen: Schmierseifenlösung (150-300 g Schmierseife auf 10 l Wasser) oder das etwas aggressivere Gemisch aus Schmierseife und Spiritus (auf 10 l Schmierseifenlösung 0,1-0,3 l Spiritus)! Die Lösung in eine Blumenspritze füllen und Blätter und Knospen tropfnass besprühen!

Was schäumt denn da?
Entdeckt man Schaum an der Rose, dann sind Schaumzikaden-Larven tätig geworden. Die Pflanzensaftsauger hüllen sich zum Schutz vor Fressfeinden in solche Schaumnester. Anders dagegen verhält es sich bei den Zikaden, die man als weiße Sprenkel auf den Blattunterseiten entdeckt. Sie fliegen schon bei leichter Berührung auf. Beide Schädlinge wird man mit Schmierseife und/oder einem Wasserstrahl wieder los, wenn der Befall nicht zu massiv ist. Ansonsten gibt es im Handel geeignete Präparate.

Was krabbelt dort in meiner Rose?
Er glänzt kupfergolden bis goldgrün, der Rosenkäfer. Viele Rosengärtner haben ihn vielleicht schon mal auf einer Blüte entdeckt und denken sofort an eine Schädlingsplage und ein zerstörtes Blumenbeet. Dabei sind Rosenkäfer bei weitem nicht so schädlich, wie man annehmen könnte. Er hat zwar eine Vorliebe für die Blütenblätter und Fruchtknoten, an denen er frisst, aber solange es sich um einzelne Exemplare handelt, ist keine Gefahr im Verzug. Man kann Tiere einfach vorsichtig von den Blüten nehmen und umsetzen. Übrigens ernähren sich die Larven des Rosenkäfers von Pflanzenresten und helfen so dabei, wertvollen Humus zu bilden. Deshalb ist der Rosenkäfer in gewisser Hinsicht ein nützliches Tier. Immerhin war er „Insekt des Jahres 2000“ und gehört schon eine ganze Weile zur Liste der bedrohten Tierarten. Unter den Käfern gibt es noch einen Rosenliebhaber – den Junikäfer. Sein richtiger Name lautet Gerippter Brachkäfer. Der kleine Bruder des Maikäfers fliegt ab Mai/Juni, ist lederbraun gerippt und am Halsschild, der Basis und an den Rändern der Deckflügel behaart. Er fliegt in der Dämmerung warmer Nächte von Ende Juni bis in den Juli hinein und ernährt sich von Blättern und Blüten, manchmal eben auch von Rosen.

Was ist denn das?
Was sich dort reckt ist die Raupe des Rosenspanners. Die Raupen, die an ein Stöckchen erinnern, ernähren sich von verschiedenen Rosenarten, beispielsweise auch von der Hundsrose (Rosa canina). In unseren Gärten findet man sie auch an Edelrosen, wo sie sich an Blättern und Blüten der beliebten Futterpflanze sattfressen. Die Raupen sind von Mai bis Juni/Juli anzutreffen. Hat sich die Raupe verpuppt, entwickelt sich daraus der Gelbe Rosen-Binderspanner, ein eher unscheinbarer ockergelber Nachtfalter mit rostbrauner Binde.

Da hilft der Rosendoktor
Hilfe, meine Rose hat Flecken und Beläge! Trotz guter Pflege werden Rosen von Krankheiten befallen. Wer die typischen Merkmale rechtzeitig erkennt, kann gezielt Erste Hilfe-Maßnahmen ergreifen.
Ringfleckenkrankheit (Sphaceloma rosarum, oben links); Sind auf den Blättern ringförmige, grau-braune Flecken mit rötlich violettem Rand zu sehen und die Blätter fallen vorzeitig ab, dann hat ihre Rose die Ringfleckenkrankheit. Die sieht nicht nur unschön aus, der Blattabfall schwächt auch die Rose. Die Pilzerkrankung tritt besonders bei feuchten Wetterperioden auf.
Sternrußtau (Diplocarpon rosae, oben rechts); Das Indiz für die Pilzerkrankung sind violettbraune bis schwarze Flecken auf der Blattoberseite, die zum Rand hin strahlenförmig auslaufen. Die Erkrankung wandert an der Pflanze von den unten nach oben, befällt also zuerst die unteren Blätter. Diese werden schließlich gelb und fallen ab.
Rosenrost (Phragmidium mucronatum) Ebenfalls eine Pilzerkrankung, die man an den kleinen gelblichen Flecken auf der Blattoberseite erkennt. Später entwickeln sich unterseits schwarze Pusteln, die Blätter fallen schließlich ab.
Echter Mehltau (Sphaerotheca pannosa var. rosae) Der weiße mehlige Belag, der sich mit den Fingern abwischen lässt, ist ein untrügliches Zeichen. Später kräuseln sich die Blätter leicht und beginnen zu vertrocknen, bis sie abfallen. Der Pilz tritt verstärkt in warmen Sommern bei hohen Tagestemperaturen und kühlen Nächten auf, da sich aufgrund des Temperaturunterschiedes Tau auf den Rosenblättern bildet, der schon für die Infektion ausreicht.
Rindenfleckenbrand (Coniothyrium wernsdorffiae). Entdeckt man an den Trieben hellbraune Flecken mit einer helleren Umrandung, ist der Rindenfleckenbrand die Ursache. Häufig sind der Stamm – die Rinde trocknet an diesen Stellen ein und reißt auf – und Vorjahrestriebe in der Nähe von Knospen oder Augen befallen.

Was tun, damit schöne & gesunde Rosenbilder den Garten prägen?
Achten Sie am besten schon beim Rosenkauf und der Sortenwahl auf widerstandfähige Sorten mit hoher Blattgesundheit. Ein Garant dafür ist das ADR-Siegel der Allgemeinen Deutschen Rosenprüfung. Nur gesunde, robuste Sorten bekommen dieses Siegel. Damit haben sie den Härtetest beim Rosen-TÜV bestanden. Das ADR Prädikat versichert, dass sich neue Sorten über mehrere Jahre ohne Pflanzenschutzmittel gegen Krankheiten und Schädlinge behaupten konnten.
Hat man sich für seine Lieblingssorten entschieden, wählt man am besten einen geeigneten Standort für die Rosen mit ausreichend Sonnenstunden, der gut durchlüftet ist, sodass die Pflanzen nach einem Regenschauer schnell trocknen. Feuchtes Kleinklima fördert nämlich das Ausbreiten von Pilzerkrankungen. Damit die Blätter schneller abtrocknen, sollte man zusätzlich für eine Belüftung der Beete sorgen; z. B. mit einem ausreichenden Frühjahrsrückschnitt und einem genügend großen Pflanzabstand. Achten Sie auch darauf, dass Begleitpflanzen nicht zu dicht an der Rose stehen!
Zur Vermeidung von Pilzerkrankungen sollte man grundsätzlich auf eine ausgewogene Düngung achten – also nicht zu viel und nicht zu wenig. Zur Vorbeugung kann man kalibetont düngen. Vor allem darf man nicht überdüngen! Insbesondere hohe Stickstoffgaben im Herbst sind unbedingt zu vermeiden. Das schwächt die Rosen eher, als dass es nützt. Die letzte Düngergabe erfolgt bei mehrfach blühenden Rosen spätestens im August, damit das Holz bis zum Winter voll ausreifen kann und sicher, also frostfest, in den Winter geht.
Zum Saisonbeginn ist es sicherlich sinnvoll, die Rosen mit einem organischen Pflanzenstärkungsmittel, z.B. mit Ackerschachtelhalmbrühe oder Algenpräparaten, zu versorgen. Das stärkt die Widerstandskraft der Rosen gegen Pilzbefall und fördert das gesunde Pflanzenwachstum Befallene Triebe kann man bis ins gesunde Holz zurückschneiden und entsorgen. Nicht vergessen: unbedingt die Schere säubern!
Infiziertes Laub unbedingt absammeln und entsorgen, damit nicht weitere Blätter oder benachbarte Rosen befallen werden. Da die Pilzsporen auf dem abgefallenen Laub überwintern, sollte man die Blätter auch rings um die Rosen aus dem Beet entfernen; sie landen bitte nicht im hohen Bogen auf dem Komposthaufen, sondern werden im Hausmüll entsorgt.

Ein bisschen Toleranz der Umwelt zuliebe
Ein paar Mehltau-Blätter oder Rosenpusteln sind noch lange kein Grund, gleich die Chemiekeule zu schwingen. Setzen Sie zunächst schonende Pflanzenschutzmittel wie Ackerschachtelhalm-Brühe ein und wechseln erst dann zur härteren Mitteln, wenn der Befall zu stark wird und die Rose ernsthaft gefährdet ist. Fragen Sie gezielt im Fachhandel nach und lassen sich gut beraten und über die richtige Anwendung aufklären. Fragen sie auch nach bienenungefährlichen Mitteln. Ein umsichtiger Umgang schadet weder uns, noch der Natur!
TEXT: Martina Raabe
FOTOS: Fotolia (11), iStockphoto (4)













