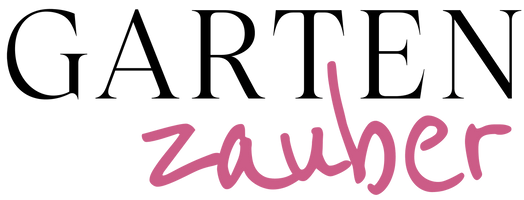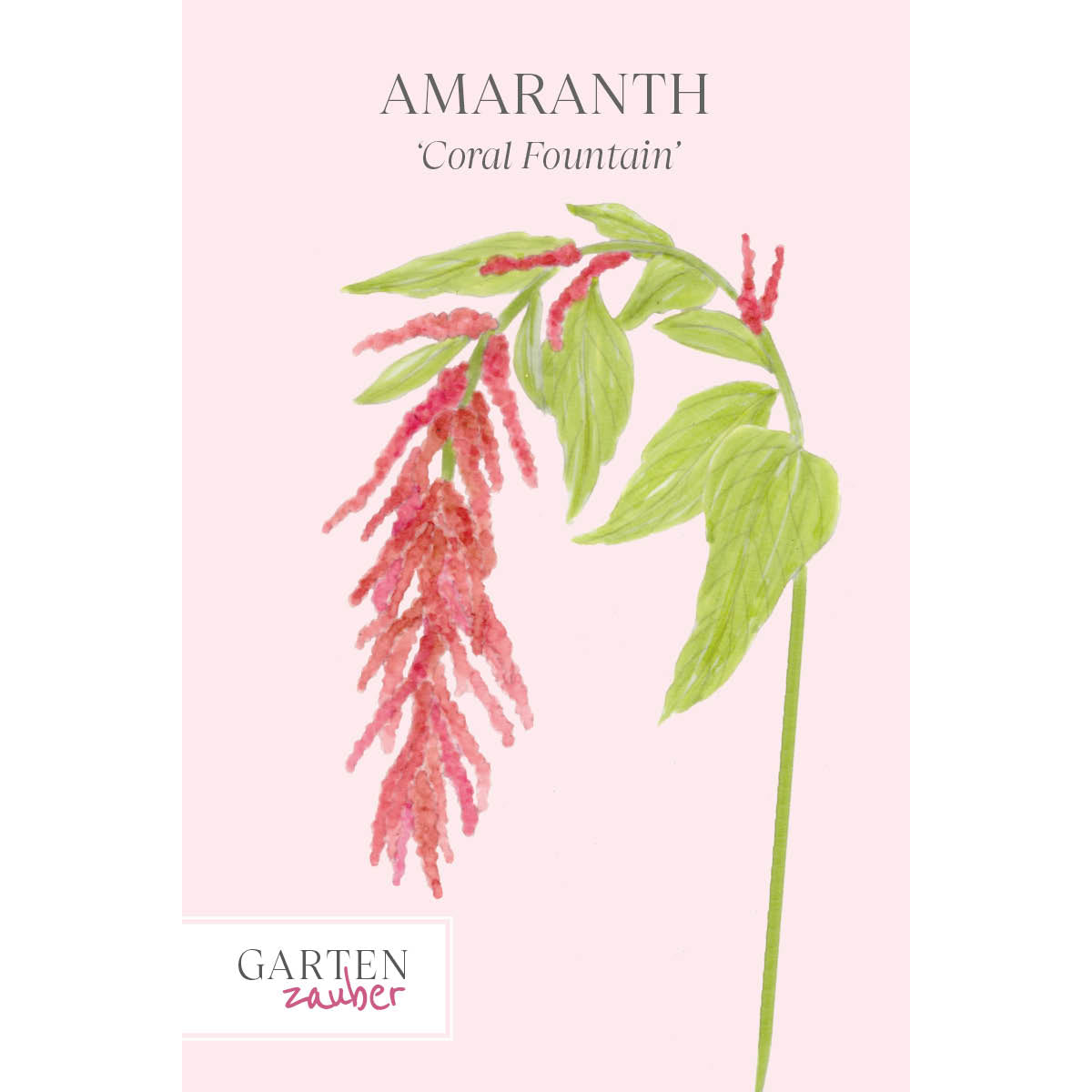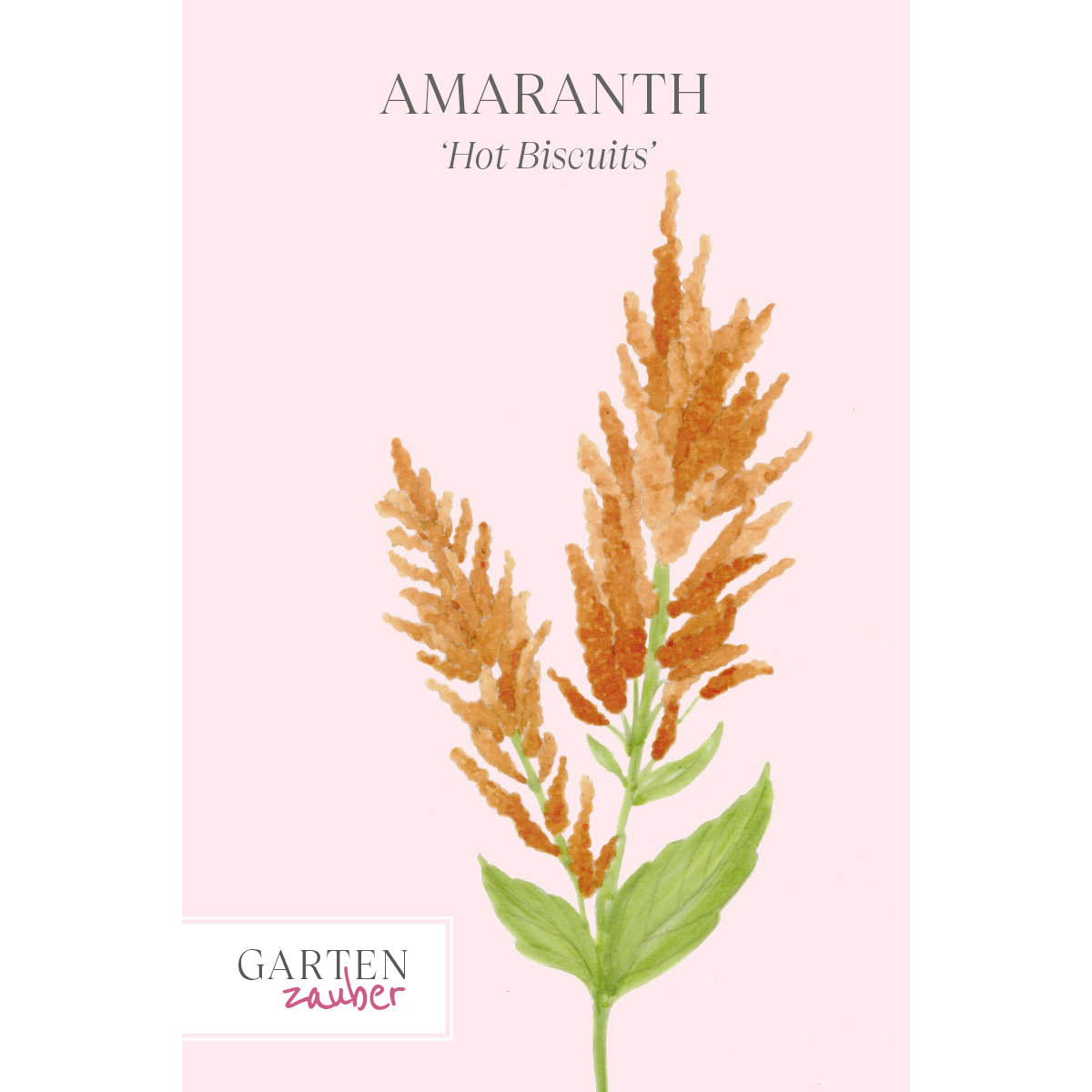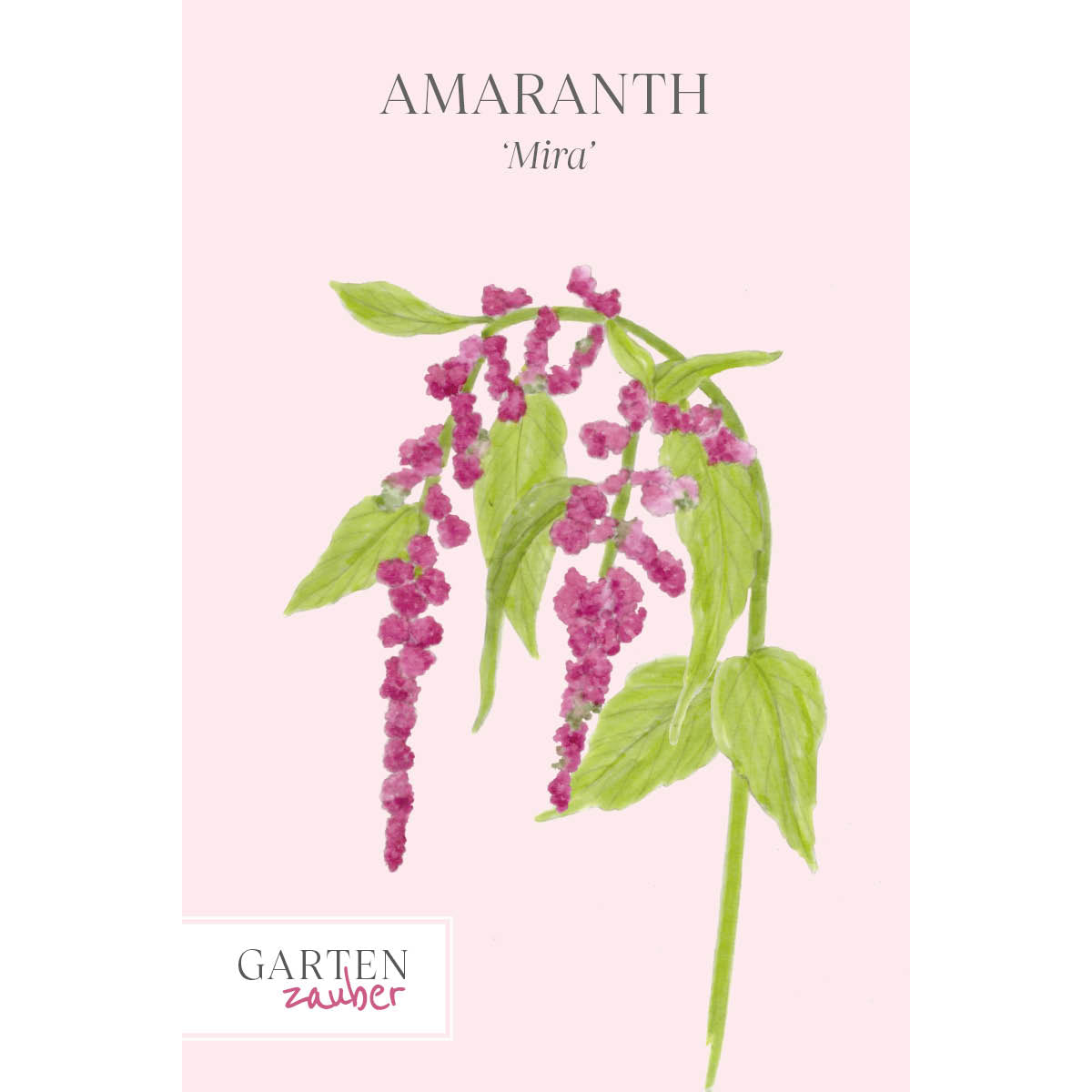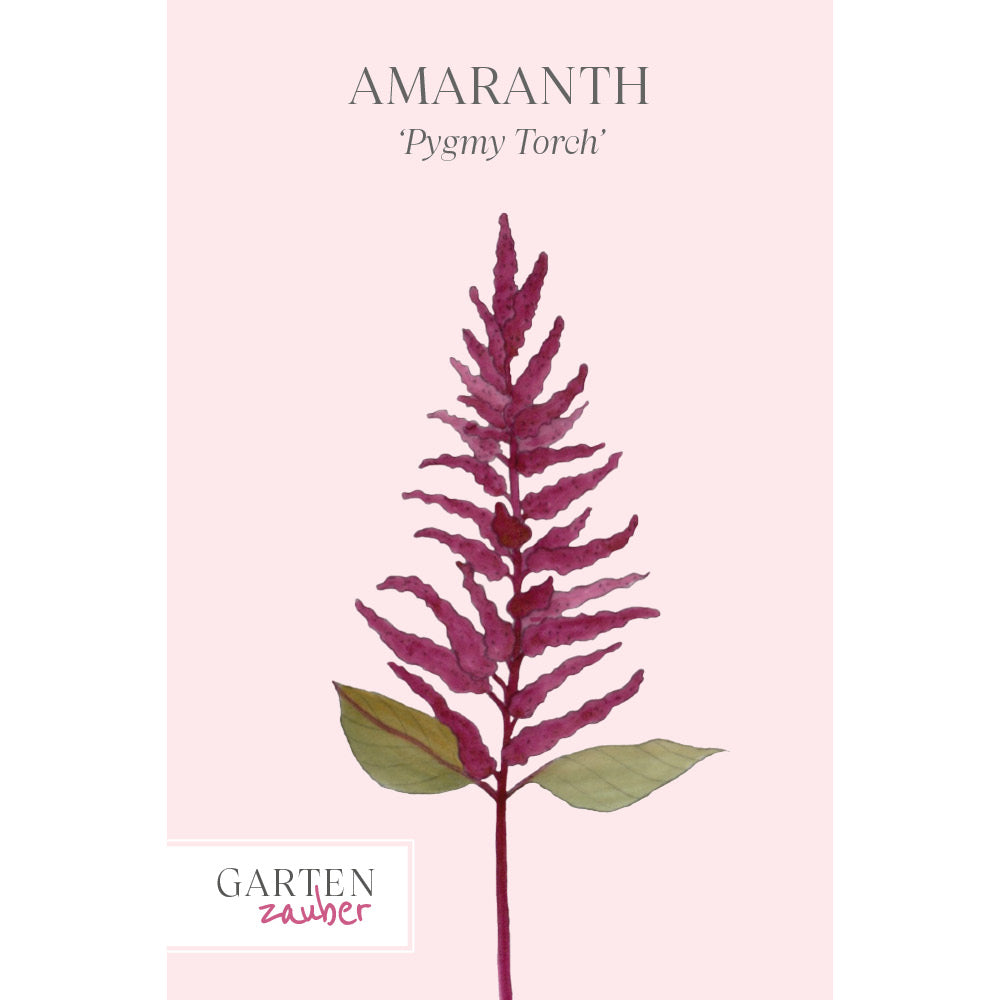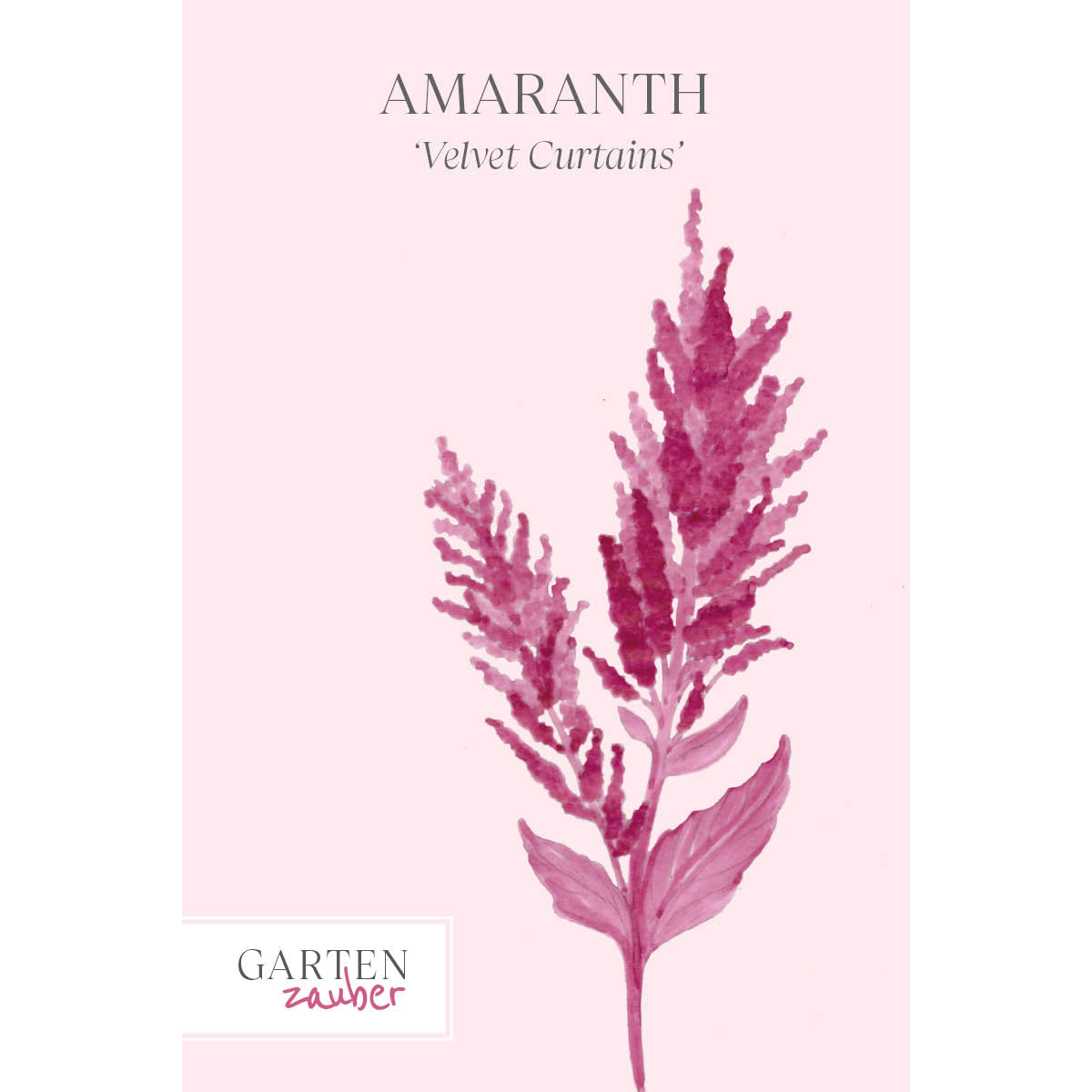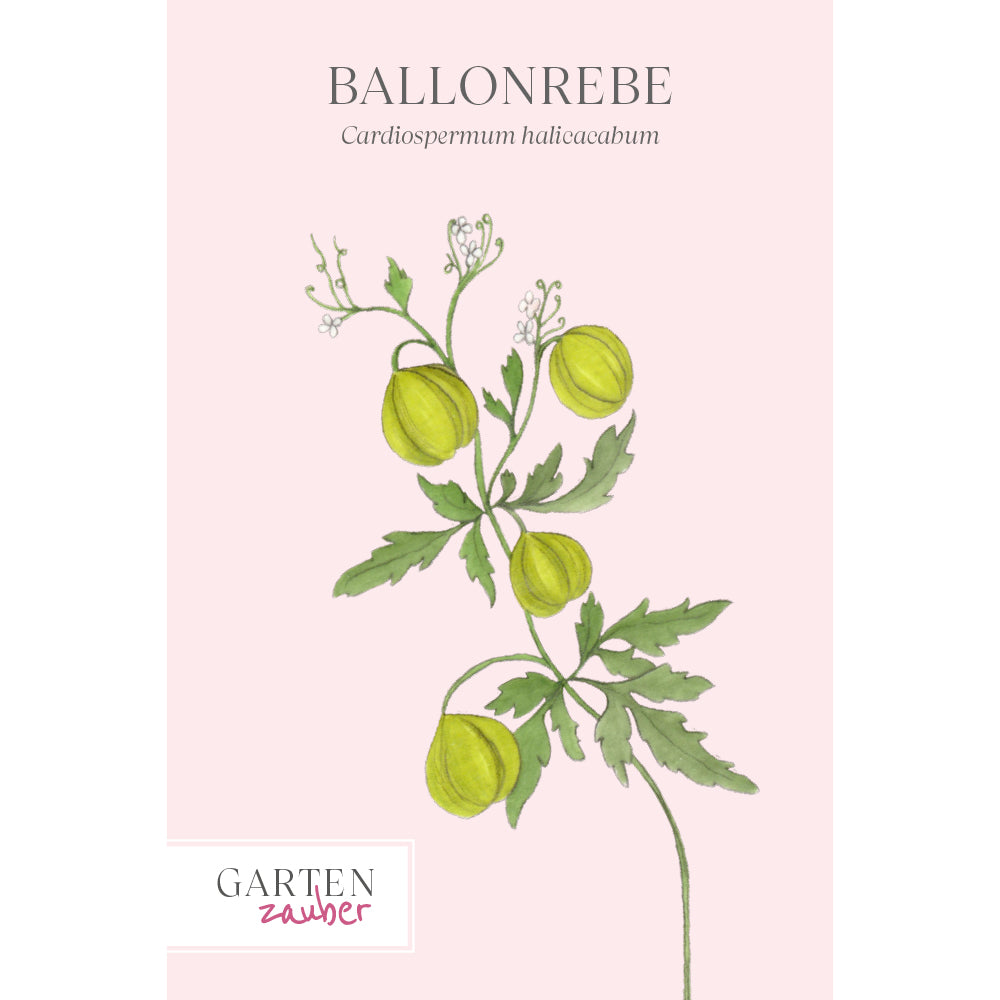Mein Name ist Hase
Der Feldhase hat es nicht leicht. In unserer intensiv genutzten Landschaft ist nicht viel Platz für Meister Lampe, dafür wollen ihm viele hungrige Beutegreifer an den dichten Pelz und im Herbst und Winter fliegen ihm dann noch die Bleischrote um die langen Ohren. Es ist also mehr als Zeit für ein Plädoyer für den Hasen.

Angepasst an das Leben in der Steppe
Wer gerne über Wiesen und Felder spaziert, kennt die Schrecksekunde, wenn direkt vor einem ein Feldhase aus seiner Kuhle, der Sasse, schießt. Meister Lampe beschleunigt dann wie ein Rennwagen, kommt auf eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 70 Stundenkilometer, schlägt Haken, dass noch der wendigste Verfolger ins Straucheln gerät und überspringt mühelos zwei Meter hohe Hindernisse. Der Hase ist eigentlich ein Steppentier. In einer Landschaft, die ihm keine Bäume als Deckung bietet, kommt er bestens klar. Seine Fellfärbung ist eine perfekte Tarnung, selbst vor den scharfen Augen großer Greifvögel. Die langen Beine sind erstaunlich muskulös und ermöglichen ihm Fluchten bei hoher Geschwindigkeit sowie abrupte Richtungswechsel.
Im Gefolge der Weidetiere
Der Feldhase ist ein Kulturfolger. Nachdem die großen zusammenhängenden Wälder gerodet und zu Feldern und Weidegründen für das Nutzvieh umgewandelt wurden, gab es neue Lebensräume, auch in unseren Breiten. Saftige Wiesen mit vielen Wildkräutern, weniger Beutegreifer als in der Steppe – dem Hasen ging es richtig gut. Dass sich Lepus europaeus, so sein wissenschaftlicher Name, so rasant verbreitete, verdankt er aber auch der Jägerschaft. Hasenbraten ist saftig und die Treibjagd auf ihn wurde im ländlichen Raum zu einem geschätzten gesellschaftlichen Event. So wurde er vielerorts als Jagdwild ausgesetzt und konnte auch weit vom europäischen Festland entfernte Inseln besiedeln.
Boxkämpfer, rennen und dann rammeln
Feldhasen mögen es warm. Erst wenn sich unsere kalten, oft regnerischen Winter dem Ende neigen, kommt wieder richtig Leben in die Hasengesellschaft. Es ist Zeit, sich um Nachwuchs zu kümmern. Die meist einzelgängerischen, heimlichen Feldhasen zeigen sich jetzt auch tagsüber, sitzen in Gruppen zusammen und geraten in den Taumel der Hormone. Die männlichen Hasen, die Rammler, liefern sich kurze und heftige Boxkämpfe um die paarungsbereiten Weibchen. Der Sieger muss der Häsin danach noch zeigen, dass er ihr im Sprint auf den Fersen bleiben kann … und dann wird gerammelt.
Nestflüchter und Überlebenskünstler
Feldhasen können bis zu vier Mal im Jahr meist zwei bis drei Jungtiere bekommen. Statistisch entfallen auf jede Häsin pro Jahr etwa zehn Junghasen. Anders als bei den im Schutz eines Baus gebärenden Kaninchen, kommen die kleinen Hasen behaart und sehend auf die Welt. Sie sind Nestflüchter. Um Energie zu sparen und nicht von ihren Feinden entdeckt zu werden, bleiben sie in den ersten Tagen fast regungslos zusammengekauert an dem Ort ihrer Geburt liegen. Später vereinzeln sie sich und kommen nur im Schutz der Dämmerung an einem Ort, den die Häsin zum Säugen gewählt hat, zusammen. 33 Tage lang versorgt die Häsin ihren Nachwuchs mit einer fettreichen Milch. Die Jungen verzehnfachen innerhalb dieses ersten Lebensmonats ihr Gewicht auf etwa ein Kilogramm. Die Sterblichkeit unter den Junghasen ist dennoch groß. Nur zwei von zehn Jungtieren überleben den ersten Lebensmonat. Greifvögel, Fuchs, Marder, Wildschweine, Hunde und Katzen fordern genauso ihren Tribut wie Kälte, Regen, Krankheiten und der Kreiselmäher.
Immer weniger zu beißen
Feldhasen bevorzugen die oberirdischen, meist eiweißarmen Pflanzenteile von Blumen und Gräsern. Nachdem das Hasenfutter den Magen passiert hat, gelangt es in den stark vergrößerten Blinddarm. Hier machen sich Bakterien und andere Mikroorganismen daran, den Pflanzenrest zu verdauen. Dabei entsteht ein für den Hasen sehr wertvoller Brei, den er direkt nach dem Ausscheiden wieder zu sich nimmt und ohne den er schnell verenden würde. Das fette, grüne Gras, das heute fast ausschließlich auf gedüngten Viehweiden wächst, bekommt den Feldhasen gar nicht. Doch die Flächen, auf denen sie sich noch mit einer gesunden Mischkost aus Kräutern und Gräsern versorgen können, schrumpfen. Der rasant steigende Anbau von Mais zur Energieerzeugung in Biogasanlagen raubt dem Langohr wichtige Lebensräume. Umweltverbände wie der WWF fordern deshalb einen Kurswechsel in der Agrarpolitik und die stärkere Berücksichtigung ökologischer Belange bei der Landnutzung.
Nur im Norden gibt es noch viele Hasen
Während lange Zeit die Bestände unserer Hasen nur über die Jagdstrecke geschätzt wurden, gibt es in Schleswig-Holstein seit 2002 in 70 ausgewählten Revieren eine gut funktionierende Hasen-Volkszählung. Nachts wird mit einem Strahler über die Felder geleuchtet. Sieht man nur ein Auge aufblitzen, kann man sicher sein, dass es sich um einen Feldhasen handelt. Fuchs, Reh und alle anderen nachtaktiven Wildtiere gucken direkt in die Lichtquelle und man sieht ein Augenpaar. Das Ergebnis: Im Norden Deutschlands geht es Meister Lampe noch vergleichsweise gut. In vielen anderen Regionen Deutschlands hat sich das Langohr längst vom Acker gemacht. Ein beklagenswerter Umstand, der dazu führte, dass der Feldhase 1994 auf die Liste der gefährdeten Tierarten kam.
Hasen im Garten
Hasen kommen nicht nur in unsere Gärten, um Eier zu verstecken. Meist ist es der Hunger, der sie ihre Scheu vergessen lässt. Im Winter nagen sie an der Rinde von Bäumen und Sträuchern. Wer nicht möchte, dass sich die messerscharfen Hasenzähne in die gehegten und gepflegten Obstbäume bohren, der lege dem Hasen Strauchschnitt zum Dranschaben und Mümmeln hin. Ab dem Frühjahr sollte der Tisch außerhalb der Gartenpforte eigentlich reich gedeckt sein. Oft sind es auch nicht Hasen, die sich an unseren Gartenpflanzen nähren, sondern Wildkaninchen. Die kleinen Verwandten kommen sehr viel besser mit der Nähe zum Menschen klar und nutzen auch innerstädtische Grünflächen.
Der wie eine Lampe leuchtet
Wie kam der Feldhase nun zu seinem fabelhaften Namen „Meister Lampe“? Schon in der Antike wurden Geschichten niedergeschrieben, in denen Tiere die Hauptrolle spielten. In den Fabeln des Mittelalters tauchte immer wieder ein Hase namens Lamprecht auf. Aus diesem Vornamen könnte sich der Name Lampe ergeben haben. Dass sich im Spurt das helle Fell des Hasenhinterteils deutlich zeigt, quasi aufleuchtet, soll ebenfalls zur „Lampe“ beigetragen haben.
Von wegen vorlaut und ängstlich
Dem Fabelwesen Lamprecht wurden die Eigenschaften vorlaut und ängstlich angedichtet. Eine Frechheit, wenn man bedenkt, wie mutig Häsinnen ihren Nachwuchs verteidigen. Auch die Hasenklage, ein klägliches Fiepen, soll Artgenossen zu Hilfe rufen, wenn es mal hart auf hart kommt. Wer schon mal gesehen hat, wie ein verdutzter Hund von einem wütenden Hasen einen auf die Nase kriegt, sieht den Mümmelmann mit anderen Augen.
60 Jahre globale Saisonarbeit
Die Vorstellung, dass Hasen vor Ostern Eier bemalen, klammheimlich in den Garten kommen, die Cholesterinbomben verstecken, damit Kinder am Ostersonntag ihre helle Freude haben, ist alt. Noch Mitte des letzten Jahrhunderts gab es aber eine regionale Jobteilung. In der Schweiz brachte der Kuckuck die Eier, es gab den Osterfuchs und auch der Hahn brachte vielerorts seinen Nachwuchs unter die Leute. Es war wohl die Schokohasen-Industrie, die darauf pochte, dass der Hase zum Monopolisten für die Auslieferung von Ostereiern wurde.
Vor diesem anpassungsfähigen, mutigen, fleißigen und leider bedrohten Säugetier ziehe ich meinen Hut!